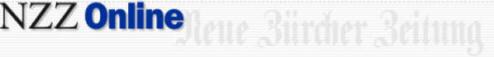
Die Schanghaier «Rikscha-Reunion»
Alles ist wie immer oder fast wie immer: Der feucht-schwüle Tagesbeginn, ein wolkenbedeckter Himmel, dafür umso deutlicher wahrnehmbar das Vogelgezwitscher aus den nassen Grünanlagen sowie der Geruch der traditionellen Ölgebäckstangen, der sich durch die noch nicht dem Fortschritt zum Opfer gefallenen engen Gassen ausbreitet - atmosphärischer Inbegriff für den Anbruch eines ganz gewöhnlichen Schanghaier Morgens nach einer regnerischen Frühlingsnacht.
So oder ähnlich muss die Wahrnehmung auch vor siebzig Jahren gewesen sein, als ungefähr 18 000 jüdische Flüchtlinge aus Nazideutschland in der Metropole am Huangpu-Fluss Zuflucht vor Hitlers Schergen fanden. Zu jener Zeit bahnten sich schwitzend, aber glücklich, dem Terror entkommen zu sein, die zumeist mittellosen Emigranten aus Berlin, Wien, Breslau und anderen Kulturstädten Europas ihren Weg auf Rikschas durch die Menschenmassen hin zu den Notunterkünften. Heute fahren klimatisierte Busse vor, denen die Vertriebenen von damals, ihre Kinder und Enkelkinder entsteigen, ausgestattet mit Digitalkameras, Handys und anderen Accessoires der modernen Welt.
Jetzt in New York, San Francisco oder Seattle lebend, versammelt sich diese Grossfamilie für einige Tage in Schanghai, um Erinnerungen auszutauschen, aber auch um den Chinesen dafür zu danken, dass die Gelbgesichter ihnen in jener schicksalhaften Zeit ein «Gefühl von Sicherheit» gegeben haben, wie es der amerikanische Organisator dieser «Rikscha-Reunion» ausdrückt. Die aus mehr als einhundert Personen bestehende Gruppe wird im Zentrum für jüdische Studien an der Akademie der Sozialwissenschaften ehrenvoll empfangen. Weiter steht der Besuch des Viertels im ehemaligen «Ghetto» von Hongkew, das die Japaner 1943 auf Geheiss der Deutschen erstellt hatten, auf dem Programm. Ein besonderes Ereignis stellt für die Gruppe die Besichtigung der Synagogen Ohel Moishe und Ohel Rachel dar, Gotteshäuser, die jahrzehntelang vernachlässigt wurden, im Zuge der Öffnung Chinas jedoch von der Stadtregierung werbewirksam aufgerüstet wurden.
Dem Grossereignis, einem der letzten dieser Art mit Überlebenden aus jener Zeit, haftet der Hauch von Nostalgie an, verbunden mit ein bisschen Wehmut. Mediengerecht berichten das staatliche chinesische Fernsehen und zahlreiche Journalisten von individuellen Schicksalen und ergreifenden Überlebensbiographien. Längst sind die Rikschas aus dem Strassenbild Schanghais verschwunden. Als Symbol Chinas und seiner vergangenen Welt aber leben sie weiter in den Köpfen dieser Menschen, die sich dank Internet und Chatroom auf diesem Stück Erde zum Gedenken an «temps passés» wiedergefunden haben.
Matthias Messmer
Diesen Artikel finden Sie auf NZZ Online unter:
http://www.nzz.ch/2006/05/13/fe/articleE3T78.html
Copyright (c) Neue Zürcher Zeitung AG